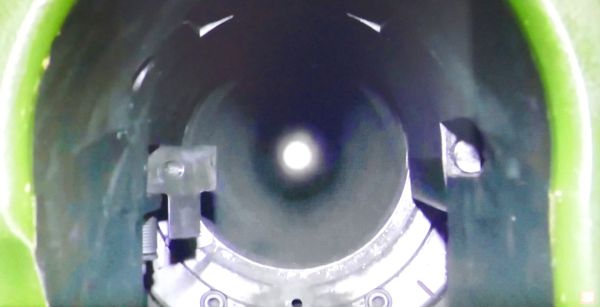Kurz vor halb sechs Uhr morgens, als ich gerade dabei bin, mir Tee zuzubereiten, klingelt das Handy. Sofort füllen sich meine Augen mit Tränen. Als ob sie nur darauf gewartet hätten, die Tränen, als ob das Handyläuten das Startsignal für sie wäre. Natürlich ist dein Vater der Anrufer. Er weiß genau, dass ich längst auf den Beinen bin, weiß genau, wie mir zumute ist, heute, an diesem besonderen Tag.
Ich gehe zum Fenster, sehe hinaus, zum Park gegenüber, der noch im Morgendunkel liegt und durch den wir unzählige Male gejoggt sind, dein Vater und ich, meist um diese Uhrzeit, während du noch tief geschlafen hast. Ich lasse das Handy läuten, lasse meine Tränen laufen, meinen Tee kalt werden, lasse meine Gedanken zu. Gedanken an kleine Episoden der vielen Jahre zu dritt, an die trügerische Selbstverständlichkeit unseres Zusammenseins. Dein Vater, du, ich.
Nun ist alles anders. Seit drei Monaten lebe ich allein. Nachdem du gegangen bist, habe ich keinen Menschen mehr in meiner Nähe ausgehalten. Vor allem deinen Vater nicht. Der Satz, dass Unglück Menschen zusammenschweißt, stimmt nicht, zumindest nicht für mich. Von Tag zu Tag habe ich es weniger ertragen, meine Trauer um dich im Gesicht deines Vaters gespiegelt zu sehen. Irgendwann hat er mein Bedürfnis nach Alleinsein akzeptiert, ist ausgezogen, hat sich eine kleine Wohnung gemietet.
„Ich betrachte das als vorübergehend“, hat er immer wieder zu mir gesagt, „nur so lange, bis du sagst, komm wieder nach Hause.“ Doch seit ich ihn mit Sara gesehen habe, bin ich unsicher, ob er wirklich zurückkommen möchte. Wie vertraut sie gewirkt haben. Du kennst sie ja, seine langjährige Kollegin, liebenswürdig und sehr hübsch ist sie, und seit kurzem außerdem geschieden. Vorgestern war es, ich ging an einem Lokal vorbei, zufällig fiel mein Blick durch das Fenster, und da sah ich die beiden. Sara hat die Hand deines Vaters gehalten, und sie haben sich tief in die Augen geschaut. Ach, egal. Seit du gegangen bist, ist alles, was mich früher aufgeregt hätte, bedeutungslos für mich geworden. Ich nehme das Handy in die Hand, das Klingeln hat längst aufgehört. ‚Ich rufe dich später zurück‘, schreibe ich, drücke auf Senden. Dann schalte ich das Handy aus. Dein Vater wird es verstehen.
Ich schminke mich. Bin dankbar für diese Möglichkeit, eine Art Schutzschicht aufzutragen. Den düsteren inneren Farben auch durch Kleidung zumindest äußerlich bunte, fröhliche entgegenzusetzen. Gerade heute, zu deinem Geburtstag, wähle ich bewusst mein bestes Outfit, ein elegantes Kleid in Eisblau, mit einem schicken beigen Blazer. Du sollst dich für deine Mutter nicht schämen müssen.
Dann spaziere ich langsam bis in die Innenstadt, setze mich in unser Café, das soeben aufgesperrt hat, bestelle Kaffee, und versuche, Zeitung zu lesen. Doch ich kann mich nicht konzentrieren. Meine Gedanken fliegen zu dir, in die Tage der Vergangenheit. Ich sehe uns beide hier sitzen, du mir gegenüber. Du bist gerade mal fünf Jahre alt, und ich muss lachen, weil du die Erwachsenen imitierst. Du hältst eine Zeitung in deinen kleinen Händen, tust mit ernstem Gesichtsausdruck so, als ob du sie lesen würdest.
Ich muss kurz die Augen schließen, sehe dann auf meine Armbanduhr. Noch zwei Stunden Zeit. Um 10:55 Uhr möchte ich bei dir sein. Genügend Zeit, um dein Geburtstagsgeschenk zu kaufen.
„Eine sehr gute Wahl“, lobt der Kassier des Mineraliengeschäftes eine Stunde später. Behutsam packt er den großen Bergkristall ein. Ich nicke, denn ich habe den schönsten Kristall gewählt, den ich hier für dich finden konnte. ‚Wirkung: Klärend, heilend‘, stand auf einem kleinen Schild darunter. Schon im Kindergarten hast du dich für Mineralien interessiert, und begonnen, sie zu sammeln.
„Ausgezeichnet“, beteuert der Kassier nochmal, nennt dann beiläufig eine hohe Summe und scherzt: „Tja, Schönheit hat ihren Preis.“
„Für meinen Sohn ist mir nichts zu teuer“, sage ich laut. Mir ist bewusst, wie arrogant mein Tonfall sich dabei anhört, kann und will aber nicht anders, als genau so zu klingen. Ich drehe mich dabei etwas zur Seite, blicke zu einer jungen Frau, die hinter mir steht, um zu überprüfen, ob diese registriert hat, welch großzügige Mutter ich bin. Sie hält ein kleines Mädchen an der einen und ein rosa Armband in der anderen Hand.
„Ein Geschenk für den Junior also“, tönt der Kassier scheinbar interessiert.
„Ja. Heute vor 14 Jahren kam mein David zur Welt“, sage ich laut und übertrieben feierlich, sehe nun direkt der jungen Frau ins Gesicht. Diese sieht demonstrativ weg, ich höre förmlich, wie sie denkt: ‚Reiche Tussi. Denk bloß nicht, dass ich mich für dich und deinen verzogenen Sprössling interessiere.‘
„Wie schön, Gratulation“, bemerkt der Kassier.
Ich bezahle, dann verlasse ich grußlos das Geschäft, rausche mit hoch erhobenem Kopf an der Frau und ihrer Tochter vorbei, die Tasche mit dem Kristall an mein eisblaues Kleid gepresst. Bin absolut in die Rolle einer hochnäsigen Mutter geschlüpft.
Ob es im breiten Feld der Psychologie einen Fachausdruck für die Sucht gibt, das Mutter-Sein vorzutäuschen? Für das Bedürfnis, zu spüren, dass fremde Menschen mich als Mutter wahrnehmen? Das Verlangen danach ist zeitweise unwiderstehlich für mich. Ich spiele alle Arten von Muttertypen, fürsorgliche, überbesorgte, oder so wie vorhin unsympathische. Lasse mich von Verkäuferinnen und Verkäufern wegen passender Kleidung oder Spielsachen für dich beraten. Gestern bin ich in einer Apotheke gewesen und habe Hustensaft für dich gekauft. „Der übliche Husten, so wie jedes Jahr um diese Zeit. Vor allem nachts quält er ihn, er kann kaum schlafen deswegen, der Ärmste“, habe ich geklagt.
Draußen sehe ich noch kurz durch das Fenster des Mineraliengeschäftes, sehe, wie die junge Mutter dem Kassier gestikulierend die Handkette reicht, sehe ihn lachen. Wahrscheinlich äfft die Frau mich gerade nach, teilt dem Kassier nun ihrerseits mit: „Vor sieben Jahren wurde meine Kimberly geboren“, und dann, affektiert, die Tatsache, dass die Kette einen Bruchteil des Bergkristall-Preises ausmacht, ignorierend: „Für meine Tochter ist mir nichts zu teuer.“
Ich greife in die Tasche, berühre die Schachtel mit dem Bergkristall. ‚Klärend, heilend‘, denke ich. Zwei Jungen kommen mir entgegen, als ich den breiten Gehsteig entlang gehe. Sie sind ein paar Jahre jünger als du, ungefähr zehn Jahre alt, einer trägt einen Fußball, hat ihn zwischen Arm und Hüfte geklemmt. Sekundenlang starre ich auf den Ball. Hinter meiner rechten Schläfe beginnt es schmerzhaft zu pochen, ich schnappe nach Luft, dann entreiße ich dem Jungen den Ball, werfe ihn mit Schwung über das hohe Gitter einer Baustelle, die sich gleich neben dem Gehsteig befindet. Er verschwindet in einer tiefen Baugrube. Kurz sehe ich in die fassungslosen Gesichter der Kinder, denke, während ich an ihnen vorbeigehe, ich müsste mich ihnen erklären, müsste ihnen von dir erzählen, ihnen sagen, dass du wegen solch eines Balls nicht mehr hier bist, wegen eines Balls, der einem kleinen, fremden Kind auf die Straße gerollt ist. Das Kind ist dem Ball nachgerannt, trotz der stark befahrenen Fahrbahn, du bist dem Kind nach, trotz der stark befahrenen Fahrbahn. Du wolltest das Kind retten. Es ist dir gelungen. Das Kind lebt. Du bist tot. Doch ich erkläre nichts, kein Wort bekomme ich heraus, sondern gehe schnell weiter, weg von den beiden Kindern, die mir nun nachbrüllen:
„He, was soll das? Warum machen Sie das?“
„Blöde Kuh!“
Ich biege um eine Ecke, taste nach dem Bergkristall.
‚Klärend, heilend.‘ Krampfhaft versuche ich, an nichts anderes zu denken als an diese beiden Worte. Meine Augen tränen, aber ich gehe weiter, zwei, drei Straßen entlang. Kurz bevor ich bei dir bin, muss ich mich setzen. Also lasse ich mich auf dem breiten Auslagevorsprung einer Bäckerei nieder, hole einen kleinen Spiegel und ein Taschentuch aus der Tasche. Meine Hände, die eine, die den Spiegel hält, die andere, die das Augen-Make-up mitsamt den Tränen abwischt, zittern stark.
Eine Frau in Arbeitskleidung kommt aus dem Geschäft. „Ist Ihnen nicht gut? Warten Sie, ich bringe Ihnen etwas Wasser.“
Eilig geht sie wieder hinein, um mir gleich darauf ein Glas zu reichen.
„Danke, es geht schon wieder“, stottere ich, „es ist nur – heute ist der 14. Geburtstag meines Sohnes.“
„Ach, alles klar – ja, ja, die Pubertät“, missversteht sie mich. „Ihr Sohn steckt wohl in Schwierigkeiten. Wissen Sie, meine Tochter ist fünfzehn. Ich sage Ihnen: Probleme in allen Bereichen, Schule, Freunde, überall. Sie kennen wohl Ähnliches von Ihrem Sohn.“
„Nein, das kenne ich nicht“, sage ich, richte mich auf. „Mein Sohn ist nicht in der Pubertät. Er steckt in keinerlei Schwierigkeiten, macht nie Probleme, im Gegenteil. David ist wunderbar, einzigartig.“
Ich gebe ihr das Wasserglas zurück. Das Lächeln der Frau gefriert.
„Na dann“, sagt sie eingeschnappt, „dann läuft ja alles bestens bei Ihnen. Gut, ich gehe jetzt mal, habe schließlich zu tun.“ Sie nickt mir kurz zu und verschwindet in der Bäckerei.
Wieder berühre ich die Schachtel mit deinem Geschenk, wieder denke ich: ‚Klärend, heilend‘, ehe ich mich aufraffe und meinen Weg fortsetze.
Zehn Minuten später bin ich bei dir, betrachte dein liebes Kindergesicht. Streichle mit meinem Blick dein helles Haar, studiere dein einnehmendes Lächeln. Dann nehme ich den Bergkristall aus der Tasche, platziere ihn zwischen Efeu und Kletterrosen auf schwarzer Erde, unter dein Foto im runden, dunklen Rahmen.
„Das sieht sehr schön aus“, sagt plötzlich jemand leise hinter mir. Dein Vater, natürlich. Ich erschrecke mich nicht, habe wohl innerlich damit gerechnet, dass er ebenfalls bei dir sein wird. Er war schließlich dabei, als du vor genau vierzehn Jahren zur Welt gekommen bist, um 10:55 Uhr. Wir haben beide damals vor Glück geweint. Dein Vater und ich sehen uns an, still, wissend, dass wir das Gleiche denken. Wir denken an dich, betrachten nun gemeinsam dein Foto. Du lächelst uns zu.
Später sitzen dein Vater und ich in der Frühlingssonne auf einer Bank in deiner Nähe. ‚Klärend, heilend‘, klingt es in mir, und dann erzähle ich deinem Vater von allem. Von dem Ball, den ich in die Baugrube geworfen habe, von der Episode im Mineraliengeschäft. Erzähle von meinem Bedürfnis, das Mutter-Sein vorzutäuschen. Es ist das erste Mal, dass ich darüber rede. Dein Vater hört mir zu. Sagt dann, das sei verständlich, dieser Drang würde sich bestimmt mit der Zeit legen.
Wir reden von dir, von unserem veränderten Dasein ohne dich, und da merke ich, dass ich deinem Vater endlich wieder in die Augen schauen kann, ohne dass mein Schmerz um dich sich wie verdoppelt anfühlt. Ich sehe in deinem Vater den geliebten Menschen, der es gut mit mir meint, der mich versteht, der weiß, wie es in mir aussieht.
Es ist inzwischen weit nach Mittag. Wir stehen auf, verlassen den Friedhof durch das schmiedeeiserne Tor. Das Auto deines Vaters steht auf dem Parkplatz. Ich zögere, würde jetzt gerne sagen: ‚Komm wieder zurück‘, aber –
„Wie geht es Sara?“, frage ich, und muss plötzlich gegen einen Kloß in meiner Kehle ankämpfen.
Er sieht mich irritiert an.
„Ich habe euch gesehen, vorgestern, in einem Lokal“, sage ich.
Dein Vater schüttelt den Kopf. „Wir haben nur miteinander geredet und uns gegenseitig getröstet. Sara hat mir von ihrer Scheidung erzählt, ich ihr von David und dir. Zwischen Sara und mir ist nichts als Freundschaft.“ Er ergreift meine Hand. „Ach, du weißt doch, dass ich die ganze Zeit darauf warte, dass du sagst …“
„Fahren wir bitte nach Hause“, sage ich. „Zusammen.“
„Wirklich?“
„Ja. Komm bitte wieder zu mir – komm zurück nach Hause.“ Erneut muss ich weinen. Dein Vater nimmt mich in die Arme.
„Nichts lieber als das“, sagt er.
Claudia Dvoracek-Iby
www.verdichtet.at | Kategorie: ärgstens | Inventarnummer: 23113