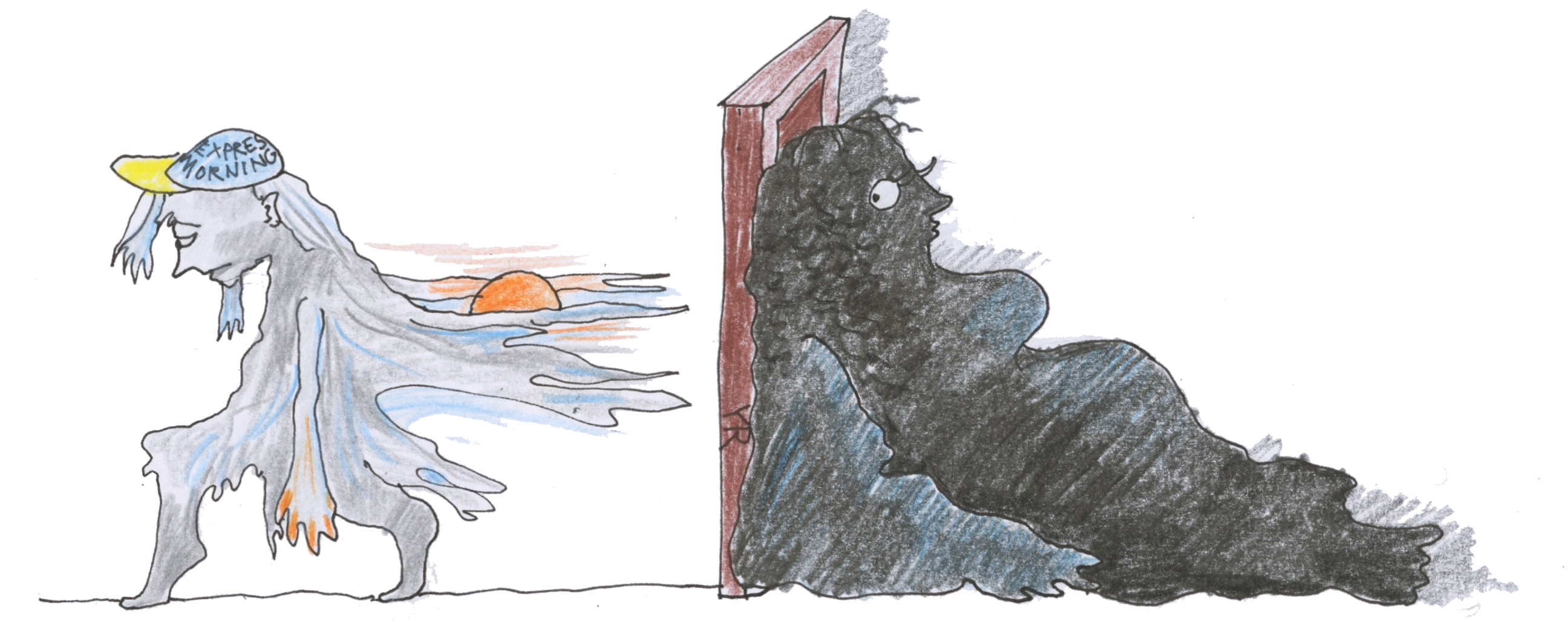1
Der Mann war unbemerkt in den Raum gekommen. Er hatte die Eingangstüre geräuschlos geöffnet und wieder geschlossen. Er stand eine Minute regungslos im Raum, dann wandte er sich um, kam an meinen Tisch und sagte: „Ist niemand hier?“
Damit meinte er, dass keine Kellnerin hinter der Bar stand und Dienst versah, und ihm dies offensichtlich missfiel.
„Das Mädchen schreibt gerade die Speisekarte“, gab ich zur Antwort.
Mein Freund Peter, der an meinem Tisch saß, musterte den Mann aufmerksamer, als er es für gewöhnlich bei fremden Menschen machte.
„Ich warte“, sagte der Mann, wandte sich zur Bar und steckte sich eine Zigarette an.
Peter sah mich fragend an. Sein Blick, das erkannte ich sofort, diente bloß einem Zweck. Ich schüttelte den Kopf und gab ihm damit zu verstehen, dass ich den Mann nicht kannte. Da ich in diesem Restaurant, das Salzamt heißt, Stammgast bin, war Peter davon ausgegangen, dass ich den Fremden kennen müsste.
Dieser stand an der Bar, sog den Rauch ein, presste ihn mit merklichem Genuss wieder aus seiner Lunge und sah sich im Raum um.
Er war um die fünfzig Jahre alt, etwa einen Meter achtzig groß und trug sein graues Haar akkurat kurz geschnitten. Seine Kleidung war von der Sorte, die man nicht in gewöhnlichen Geschäften kauft. Sie war maßgeschneidert, wie auch seine schwarzen Lederschuhe Maßanfertigungen waren. Trotz des offensichtlich hohen Preises seiner Ausstattung wirkte er keineswegs abgehoben, sondern leger. Er trug eine lockere Haltung zur Schau, die aus seinem Inneren kam und nicht aufgesetzt war, das merkte ich sofort.
„Guten Abend. Was kann ich für Sie tun?“ Die Kellnerin war mit der Speisekarte fertig und in den Raum zurückgekommen, in dem sie Dienst tat.
„Guten Abend, Fräulein“, sagte der Mann freundlich. „Ich möchte einen Tisch für Donnerstag reservieren. Wir werden fünf Personen sein. Zwanzig Uhr wäre ideal.“
Das Mädchen trug die Reservierung in den eigens dafür bereitliegenden Kalender ein.
„Vielen Dank. Bis Donnerstag“, sagte er und machte sich auf den Weg zur Türe. Bevor er sie öffnete, blickte er mich an und zwinkerte mir zu. „Wir sehen uns, Michael“, sagte er, dann verließ er das Salzamt.
Nachdem er gegangen war, sagte mein Freund Peter: „Ich dachte, du kennst ihn nicht.“
„Ich – kenne – ihn – auch – nicht“, sagte ich leise und langsam.
Es hatte etwas in den Augen dieses Mannes gelegen, als er mich das zweite Mal angesprochen hatte, das mich beunruhigte. War er beim ersten Mal freundlich gewesen und hatte ein gutmütiger, beinahe warmer Blick seine Augen erleuchtet, so hatte seine Stimme kurz darauf einen bösen, kalten Ton angenommen. Weit mehr noch als seine Stimme hatte mich der Ausdruck in seinen Augen irritiert, und sogar verängstigt.
In diesen Augen hatte etwas gelegen, das ich nie zuvor gesehen hatte. Es war ein beinahe animalischer Ausdruck, etwas Unmenschliches, das zum freundlichen Blick von vorhin nicht gepasst hatte.
Außerdem hatte dieser Mensch meinen Namen gekannt, obwohl ich nicht damit angesprochen worden war, weder von der Kellnerin noch von meinem Freund.
„Was ist los mit dir?“, fragte Peter. „Geht es dir nicht gut?“
Ich atmete tief ein und behielt die Luft zehn Sekunden in mir – das ist meine Art, mit Panikattacken fertigzuwerden. Es funktionierte, ich wurde innerlich wieder ruhig und steckte mir eine Zigarette an.
„Es ist alles in Ordnung, Peter“, gab ich zurück.
„Woher kennt der Mann deinen Namen?“, fragte er, doch ich ging nicht auf seine Frage ein.
„Sag, Peter, hast du seine Augen gesehen, als er sich an der Türe umgedreht und mich angesprochen hat?“
„Natürlich. Sie waren gleich freundlich wie zuvor, als er mit dem Mädchen gesprochen hat.“
„Hast du eine Veränderung in seiner Stimme bemerkt?“
„Nein, habe ich nicht“, sagte er. „Was war denn mit seiner Stimme?“
„Sie war verändert. Sie klang eiskalt.“
„Eiskalt?“, wiederholte Peter verwundert. „Sag, bist du betrunken?“
„Nein, bin ich nicht. Lassen wir das Thema.“
Der Abend nahm den gewohnten Lauf aller Abende im Salzamt. Ich unterhielt mich mit meinem Freund, wir tranken Bier und konnten die Kellnerin dazu überreden, an unserem Tisch Platz zu nehmen.
Peter, der, anders als ich, einer geregelten Arbeit nachging, verließ das Restaurant um Mitternacht, und ich blieb mit dem Mädchen am Tisch sitzen. Nachdem die beiden anderen Stammgäste, die jeden Abend an der Bar stehen, das Lokal verlassen hatten, fasste ich mir ein Herz und fragte die Kellnerin: „Martina, ich möchte nicht neugierig erscheinen, und ich weiß dass mich das nichts angeht, aber ich habe eine Frage.“
„Ja?“, sagte sie und sah mich erwartungsvoll an.
„Hat der Mann, der den Tisch für Donnerstag reserviert hat, seinen Namen genannt?“
„Nein, hat er nicht. Weißt du denn nicht, wie er heißt? Er schien dich jedenfalls zu kennen.“
„Ich kenne ihn aber nicht. Sag, ist dir etwas an seiner Stimme aufgefallen, als er gegangen ist?“
„Nein, gar nichts.“
Zur Sperrstunde verließen wir das Salzamt, und ich ging nach Hause. Dort lag ich noch eine halbe Stunde wach im Bett und zermarterte mir den Kopf, was es mit diesem Mann auf sich haben konnte.
Kurz bevor ich einschlief, beschloss ich, bis Donnerstag nicht mehr an ihn zu denken.
2
Am Donnerstag betrat ich das Salzamt um siebzehn Uhr und setzte mich an meinen Lieblingstisch. Ich schlug mein Schreibheft auf und begann an einer Kurzgeschichte weiterzuschreiben, die ich Tage zuvor begonnen hatte. Claudia hatte Dienst an der Bar, was mir sehr gelegen kam. Sollte sich nämlich Ähnliches zwischen dem Mann und mir ereignen wie vor zwei Tagen, hätte ich eine unvoreingenommene Person bei der Hand.
Ich schrieb bis Viertel vor acht, dann legte ich den Stift weg und wartete auf das Eintreffen des Mannes mit seiner Entourage. Pünktlich um acht betrat er in Begleitung von vier Frauen seines Alters das Restaurant. Er würdigte mich keines Blickes, ließ sich bloß zu einem knappen Gruß an Claudia herab und ging schnurstracks in den Gastraum.
Ich war ein wenig enttäuscht, doch auch erleichtert. Ich versuchte an der Kurzgeschichte weiterzuarbeiten, doch fiel mir nichts ein, das es wert gewesen wäre, niedergeschrieben zu werden. Innerlich fragte ich mich in einem fort, was ich denn erwartet hatte, welche Handlung dieses Mannes.
Gegen zweiundzwanzig Uhr verließ er das Lokal samt seinen Begleiterinnen. Als er an meinem Tisch vorbeikam, legte er wortlos und ohne mich anzusehen eine in der Mitte gefaltete Papierserviette auf diesen.
Ich nahm die Serviette und klappte sie auf. Mit schwarzer Tinte stand darauf geschrieben: ‘Wir sehen uns, Michael Timoschek. Morgen – Salzamt – 21.00 Uhr – alleine!’
Mir wurde abwechselnd heiß und kalt. Die Schrift hatte gleichzeitig etwas Feierliches und etwas Bedrohliches. Feierlich, denn Tinte auf einer Serviette wirkt edel, wie ich finde, und bedrohlich, weil die feinen Verästelungen in schwarzer Farbe, für die die Saugfähigkeit der Papierserviette verantwortlich war, mich an die Äste von dürren, abgestorbenen Büschen erinnerten, jenen auf Friedhöfen gleich, die auf verlassenen, ungepflegten Gräbern wachsen.
Claudia war nicht entgangen, dass der Mann mir eine Nachricht hatte zukommen lassen und dass ich diese gelesen hatte.
„Hat er dir seine Telefonnummer gegeben, Michael?“, fragte sie keck.
Ich faltete die Serviette zweimal und steckte sie in meine Hosentasche. Einen Augenblick lang war ich versucht, ihr die Wahrheit zu sagen, doch dann beschloss ich zu lügen. Ich fürchtete nämlich, die Kellnerin würde die Sache nicht verstehen und mich für endgültig übergeschnappt halten.
„Ja, Claudia, das hat er. Er hat mir auch seine E-Mail-Adresse aufgeschrieben.“
„Wer ist er?“, fragte sie. „Er scheint reich zu sein.“
„Er ist sogar sehr reich“, fabulierte ich. „Ihm gehört ein großer Verlag, und ich habe ihm einige Manuskripte geschickt.“
„Das ist gut, Michael. Wird er ein Buch von dir herausbringen?“
„Ich hoffe es, Claudia. Morgen treffen wir uns hier und werden wohl wichtige Details besprechen. Es erfordert nämlich viele Gespräche, bis so ein Projekt auf Schiene ist, musst du wissen“, sagte ich.
Ich gab mich erfahren im Literaturbetrieb, obwohl ich kaum Ahnung davon hatte und habe.
„Das freut mich ja so für dich!“, rief sie und gab mir einen Kuss auf die Wange. „Zur Feier des Tages geht dein nächstes Bier aufs Haus.“
Ich fühlte mich plötzlich mies. Ich hatte die herzensgute Claudia angelogen, weil ich zu feig war, die Wahrheit zu sagen – und als Lohn für meine Lügen sollte ich ein Freibier erhalten. Es schmeckte ausgezeichnet.
Nachdem ich das Glas ausgetrunken hatte, gesellte ich mich zu den beiden Stammgästen an der Bar und führte ungezwungen Konversation mit ihnen. Ich wollte mich von den Gedanken abbringen, die ständig durch meinen Kopf waberten – Gedanken an den nächsten Abend und an das, was der Mann von mir wollen mochte.
3
Am nächsten Tag konnte ich keine feste Nahrung zu mir nehmen, so aufgeregt war ich. Ich lief in meiner Wohnung umher, ich versuchte es mit einem Spaziergang am Donaukanal, doch nichts half. Ich überlegte, ob es Sinn machen würde, Peter anzurufen und ihn einzuweihen, doch entschied ich mich dagegen. Er hätte mir womöglich unterstellt, die Serviette selbst beschriftet zu haben. Fernsehen half ebenso wenig wie das Bügeln meiner Hemden, also verbrachte ich den Großteil des Tages im Bett und las.
Um zwanzig Uhr betrat ich das Salzamt und setzte mich an meinen Tisch. Brigitte hatte Bardienst. Sie war neu, und wir kannten uns noch nicht gut, also blieb sie an ihrem Platz hinter der Bar und setzte sich nicht zu mir. Dies war mir nur recht, denn ich war innerlich höchst angespannt und wollte meine Ruhe haben.
Um neun Uhr betrat der Mann das Lokal und setzte sich neben mich auf die Bank aus braunem Leder.
Ich schwieg, wollte ihn den Anfang machen lassen.
„Michael Timoschek“, sagte er.
„Und mit wem habe ich die Ehre?“, fragte ich.
„Mit dir selbst“, gab er zurück.
Ich blickte ihn verdutzt an, dann bedeutete ich der Kellnerin, an meinen Tisch zu kommen. Der Mann bestellte Bier. Ich machte ein paar Scherze, als Brigitte das Glas brachte, und sie lachte. Es ging mir nicht darum, das Mädchen zum Lachen zu bringen, ich wollte bloß Zeit gewinnen; Zeit, um mir eine Reaktion auf seinen Satz zu überlegen.
„Okay“, sagte ich und legte einen Tonfall in meine Stimme, als hätte ich es mit einem gefährlichen Irren zu tun, dem man mit Vorsicht begegnen sollte, um ihn nicht zu reizen.
„Schreiben, trinken, um Geld betteln. Das ist dein Leben“, stellte er fest.
„Nun“, mehr konnte ich nicht dazu sagen. Er hatte recht.
„Oberflächlichen Gören nachlaufen, faulenzen, dich in Träumereien verlieren. Auch das ist dein Leben“, fuhr er fort.
Ich schwieg.
„Wo führt das hin?“
Nun sah ich meine Chance gekommen, etwas über den mysteriösen Fremden in Erfahrung zu bringen.
„Ich vermute“, sagte ich, „dass es dahin führen wird, dass ich in etwa fünfzehn Jahren in einem Maßanzug und in Maßschuhen herumlaufen werde.“
Erst lachte er, dann trat wieder der unmenschliche Blick in seine Augen.
„Wer sind Sie?“, fragte ich. „Und woher zum Teufel wissen Sie, wer ich bin?“
„Ich bin Gustav Fischer. Und ich weiß, wer du bist. Ich weiß auch, was du bist.“
„Was bin ich denn?“
„Zur Zeit ein Poète maudit, das bist du.“
„Was sind denn Sie?“
„Ein Mensch, den du viele Jahre lang enttäuscht hast.“
Ich fühlte, wie sich eine gewisse Ungeduld in mir auszubreiten begann. Wenn ich Informationen erhalten möchte, schätze ich es nicht, auf diese warten zu müssen.
„Dann könnte ich auch ebenso gut Vater zu dir sagen“, fauchte ich. Die förmliche Anrede schien mir einfach nicht mehr angebracht. „Mein Alter ist auch von mir enttäuscht.“
„Ich bezweifle, dass er der Einzige in deiner Familie ist.“
Da wurde es mir zu bunt.
„Jetzt pass auf, du Anzugträger!“, sagte ich in aggressivem Ton. „Entweder du sagst mir sofort, wer du bist, oder zu sein glaubst, und was du von mir willst, oder ich zerre dich an deinen Ohren nach draußen!“
„Gemach, Herr Autor, gemach!“, murmelte Gustav Fischer. „Ich habe viele Jahre lang mein Talent vergeudet. Die Tatsache, dass ich heute Kleidung trage, die du dir selbst nach drei Jahren des Sparens nicht leisten könntest, sollte dir zu denken geben.“
„Ach. Und warum?“
„Weil ich eines Tages aufgehört habe, mein Talent zu vergeuden, und dann bin ich erfolgreich geworden.“
„Auf welchem Gebiet, wenn ich fragen darf?“
Es interessierte mich nicht wirklich, in welchem Bereich der Mann tätig war, doch wenn er sich schon dazu berufen fühlte, mir Vorhaltungen zu machen, sollte er wenigstens ein bisschen von sich preisgeben müssen.
„Wirtschaft, Bankvorstand“, sagte er knapp.
„Habe ich bei deiner Bank etwa auch Schulden?“, fragte ich. „Groß wundern würde es mich nicht.“
„Nein, Timoschek, hast du nicht.“
„Was willst du, Fischer?“
„Du bist der Teller, der einen Sprung hat“, begann er. „Der im Regal ganz hinten steht, weil er niemandes Augen mehr zugemutet werden kann, weil er eine Schande für die Familie ist, in deren Haus er steht. Bloß ab und zu holt man ihn hervor, um Speisereste auf ihm abzulegen.“
„Das kenne ich“, sagte ich gelangweilt. „Ich habe den Text gelesen.“
„Du bist der bis zur Krone im Morast versunkene Baum. Kennst du das auch?“
„Nein, aber sprich weiter“, murmelte ich und simulierte Gähnen. „Es klingt überaus interessant.“
„Du träumst von einem guten Auskommen, von Ruhm und Geld. Doch am öftesten träumst du von einer Person, die dich an der Hand aus deinem Morast herausführt.“
Ich schwieg. Gustav Fischers Worte hatten ins Schwarze getroffen.
„Und jedes Mal, wenn du die Hand ausstreckst nach einer solchen Person – was passiert dann?“
„Keine Ahnung“, sagte ich lakonisch. „Ich werde an der Hand herausgeführt?“
„Nein, Timoschek. Es passiert etwas anderes: Dein Traum zerplatzt.“
„Woher willst du wissen, dass es sich wirklich so verhält, Fischer?“
„Das sind doch deine Themen, an welchen du dich abarbeitest. Mit welchen du dein Talent vergeudest. Die dich dazu bringen, zu billigen Tricks und Rhetorik zu greifen.“
„Wie kommst du darauf?“, rief ich entrüstet.
Ich war keineswegs der Meinung, dass ich mein Talent vergeudete.
„Bist du dir eigentlich im Klaren darüber, dass in der Kunst alles erlaubt ist, Gustav Fischer?“, fragte ich zornig.
„Erlaubt ist alles, Timoschek. Aber es ist bei Weitem nicht alles Erlaubte auch gut!“
„Dann erzähl mal, womit du dein Talent vergeudet hast. Nachdem du heute angeblich Bankvorstand bist, kann es bei dir mit dem Talent ja nicht allzu weit hergewesen sein.“
„Das tut hier nichts zur Sache!“, knurrte er und sah mich aus seinen unmenschlichen Augen an, in welchen ich eine gute Portion Verachtung erkannte. „Es geht hier um dich!“
„Na schön!“ Ich gab auf. „Lies mir die Leviten! Sag mir, was du zu sagen hast, Fischer!“
„Du musst aufhören, dein Werk zu verpfuschen!“
„Ja, mit billigen Tricks und Rhetorik. Das hatten wir schon.“
„Warum machst du damit weiter?“
„Womit denn?“ Ich begann die Beherrschung zu verlieren.
„Mit den Tricks und dem Geschwafel!“
„Wo kommt so etwas denn vor?“, rief ich.
„Wo Schachtelsätze bei dir vorkommen? Überall!“
Ich dachte nach. Er hatte recht, doch konnte ich das nicht so einfach zugeben.
„Na und?“
„So etwas will niemand lesen! Und was soll der Schwachsinn mit den Türkentauben?“
Ich schwieg.
„Warum tauchen diese Vögel in so vielen deiner Werke auf? Wahrscheinlich weil du einem Rock nachläufst, der diese Viecher gern hat!“
Ich schwieg weiter.
„Und erst das, was du aus vorgegebenen Themen machst! Ein wenig Fantasie könnte nicht schaden! Nie versuchst du, das Unmögliche möglich zu machen! Die Vermutung, dass der Alkohol nicht ganz unschuldig daran ist, liegt weiß Gott nahe!“, herrschte er mich an.
Die Tatsache, dass ein Fremder mir Vorhaltungen bezüglich meiner Kunst machte, trieb mir die Zornesröte ins Gesicht. Dennoch war ich unfähig, etwas zu meiner Verteidigung vorzubringen.
„Denk darüber nach, Timoschek! Fantasie und kurze Sätze – mehr braucht es nicht, abgesehen von einer Änderung deiner Lebensführung, und zwar einer radikalen Änderung!“
Der Mann trieb mich zur Weißglut, doch hatte ich seinen Worten nichts entgegenzusetzen.
Ich trank den Rest meines Bieres in einem Zug, erhob mich und drückte der Kellnerin einen Geldschein von ausreichendem Wert in die Hand.
Dann ging ich zum Tisch zurück, sah dem Mann tief in die Augen und wandte mich um. Im Hinausgehen machte ich kehrt, um ihm eine letzte Frage zu stellen.
„Bevor ich gehe, habe ich noch eine Frage an dich“, sagte ich.
„Nur zu!“
„Wer bist du wirklich?“
„Dein Leser.“
Michael Timoschek
www.verdichtet.at | Kategorie: Wortglauberei |Inventarnummer: 17059